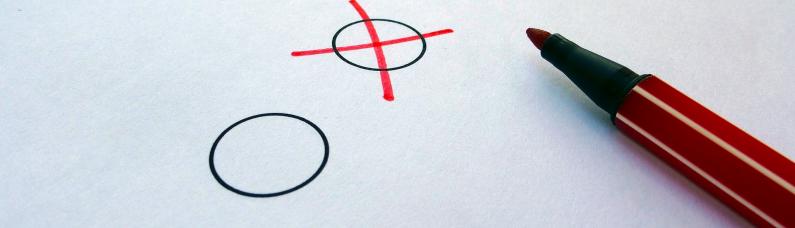
14 Forderungen zur Bundestagswahl
Forderungen der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung zur Bundestagswahl 2021
Zivile Konfliktbearbeitung in Deutschland und Europa stärken
- Die Zivile Konfliktbearbeitung in Deutschland kann der zunehmenden gesellschaftlichen und politischen Polarisierung entgegenwirken, Gewalt und Radikalisierung verhindern und eine gewaltfreie Streitkultur fördern.
Die nächste Bundesregierung sollte Zivile Konfliktbearbeitung als zentrales Handlungsfeld in das Programm „Demokratie Leben!“ und vergleichbare Programme aufnehmen sowie eine gesetzliche Grundlage zur Förderung einer wehrhaften und lebendigen Demokratie etwa im Rahmen eines Demokratieförderungsgesetz schaffen.
- Auch die Europäische Union muss Antworten auf die zunehmenden innergesellschaftlichen Konflikte und Polarisierung in den Mitgliedsstaaten finden.
Die nächste Bundesregierung sollte daher ein neues EU-Programm zur innergesellschaftlichen und kommunalen Konfliktbearbeitung vorschlagen, das die Kompetenzen zivilgesellschaftlicher und kommunaler Akteur*innen in Ziviler Konfliktbearbeitung stärkt.
Zivilgesellschaft und Friedensförderung weltweit stärken
- Zivilgesellschaftliche Organisationen haben eine entscheidende Bedeutung für die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs). Doch diejenigen, die sich für Menschenrechte, Umweltschutz und Frieden einsetzen, werden immer häufiger in ihren Aktionsmöglichkeiten eingeschränkt, bedroht oder gar ermordet. Die politische und finanzielle Unterstützung von Zivilgesellschaft muss eine Priorität der Politik im Inland sowie in der Außen- und Entwicklungspolitik sein.
- Die Haushaltsmittel für zivile Konfliktbearbeitung und Friedensförderung, für den Zivilen Friedensdienst und das Förderprogramm zivik, für Programme zum Ausbau von Mediationskapazitäten sowie zivilgesellschaftliche Programme der Kirchen und Nichtregierungsorganisationen müssen deutlich und planvoll erhöht werden und es müssen für alle Programme mehrjährige Förderzusagen eingeführt werden.
- Die Europäische Union war und ist für viele zivilgesellschaftliche Akteur*innen in Europa und im globalen Süden eine wichtige Unterstützerin. Im Rahmen der jährlichen EU-Haushaltsplanung sollte sich die Bundesregierung für eine deutliche Erhöhung der Etats für Entwicklungszusammenarbeit, Förderung von Demokratie und Menschenrechten sowie Zivile Konfliktbearbeitung und Friedensförderung einsetzen. Und sie muss sicherstellen, dass Mittel aus diesen Etats entsprechend den ODA-Kriterien, bzw. ausschließlich für zivile Zwecke verwendet werden.
Strukturelle Konfliktursachen adressieren
- Ein wichtiger Beitrag zum Frieden ist es, negative Auswirkungen deutscher Politik und Gesetzesvorhaben auf Konfliktdynamiken in anderen Ländern zu vermeiden. Daher sollte analog zur Prüfung nach dem Do-No-Harm-Prinzip für Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit in fragilen Staaten und zur bestehenden Nachhaltigkeitsprüfung eine Prüfung der Friedensverträglichkeit von Gesetzesvorhaben eingeführt werden.
- Auch die EU-Nachbarschaftspolitik sollte sich an Krisenprävention und ziviler Konfliktbearbeitung ausrichten und die Ursachen von Gewaltkonflikten in den Blick nehmen. Um die Zusammenarbeit der EU mit den afrikanischen Staaten zu verbessern, muss die Kooperation mit Regionalorganisationen wie der Afrikanischen Union (AU) und ECOWAS ausgebaut werden und deren diplomatisches Potenzial stärker genutzt werden.
- Eine gleichberechtigte Partnerschaft beispielsweise mit der AU und ihren Mitgliedsstaaten ist nur möglich, wenn Europa sich seiner Schuld und Verbrechen der Kolonialzeit offen stellt. Die nächste Bundesregierung sollte sich gegenüber den EU-Mitgliedsstaaten für eine europäische Debatte über das koloniale Erbe Europas und einen entsprechenden Dialog mit Ländern und Akteur*innen des globalen Südens einsetzen. Solche Dialoge müssen staatliche und zivilgesellschaftliche Akteur*innen beteiligen.
Rüstungsexporte restriktiver und rechtsverbindlich regeln
- In Deutschland sollte die Bundesregierung umgehend ein restriktives Rüstungsexportkontrollgesetz auf den Weg bringen, das Lieferungen an Drittstaaten ausschließt und Exporte streng kontrolliert. Nur so kann verhindert werden, dass aus Deutschland Waffen oder militärische Ausrüstung in Kriegs- und Krisenregionen oder in Länder, die an kriegerischen Handlungen beteiligt sind und/oder Menschrechte systematisch verletzen, gelangen.
- Zusätzlich sollte sich die Bundesregierung für eine gemeinsame rechtsverbindliche, restriktive Verordnung der Europäischen Union zur Rüstungsexportkontrolle einsetzen. Waffenlieferungen aus der EU an Drittstaaten, die an Kriegen beteiligt sind oder deren Regierungen Menschenrechte verletzen müssen ausgeschlossen werden.
Sicherheitspolitik friedenslogisch gestalten
- Die Bundesregierung sollte das Konzept Gemeinsamer, kooperativer Sicherheit weiterentwickeln und in allen multilateralen Institutionen (OSZE, NATO, Vereinte Nationen) mit Nachdruck vertreten. Dazu sollte die Bundesregierung multilaterale Institutionen – allen voran die VN und ihre Regionalorganisationen – stärken und ihre finanziellen und personellen, nicht zweckgebundenen Beiträge für internationale Institutionen wie die OSZE und Finanzierungsinstrumente der Vereinten Nationen und ihrer Unterorganisationen für Abrüstung, Frieden und Menschenrechte deutlich erhöhen.
- Abrüstung und Rüstungskontrolle müssen finanziell und personell gestärkt werden. Die Bundesregierung sollte dafür eintreten, als ersten Schritt weltweit die Rüstungsetats um 10% zu senken, damit in allen Staaten mehr Mittel für Maßnahmen zur Umsetzung der SDGs, des Klimaschutzes und der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie zur Verfügung stehen.
- Der Bundestag und die Bundesregierung müssen den Beschluss des Deutschen Bundestags von 2010 zum Abzug der letzten in Deutschland stationierten Atomwaffen umsetzen und Deutschland muss dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag beitreten.
- Die nächste Bundesregierung muss die Friedens- und Konfliktforschung weiter ausbauen und dabei sowohl die Vielfalt der Einrichtungen und Forschungsgebiete als auch die internationale Vernetzung sowie den Austausch von Forschung und Praxis stärken. Entsprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrats muss sie dringend die Fördertätigkeit der zuständigen Bundesstiftung, der Deutschen Stiftung Friedensforschung, finanziell langfristig absichern.
Berlin, Februar 2021
Herausgegeben vom Sprecher*innenrat der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung.
Weitere Informationen zur Bundestagswahl finden Sie hier.