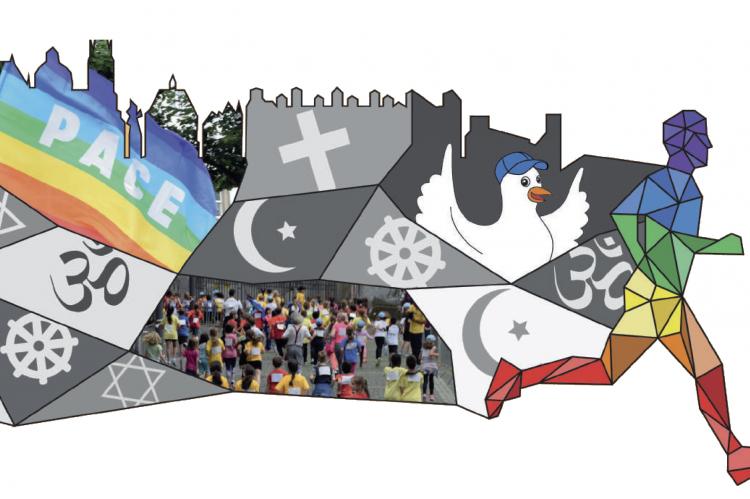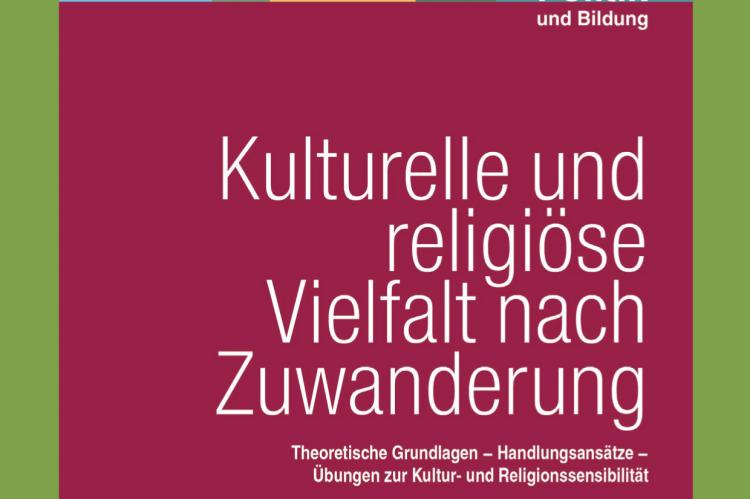Prof. Dr. Josef Freise beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Phänomen religiös motivierter Gewalt und den friedenschaffenden Impulsen von Religion. Wir haben ihn um eine Einschätzung darüber gebeten, welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen, um religiösem Fundamentalismus begegnen zu können.
In seinem folgenden Beitrag verweist Josef Freise einerseits auf die Notwendigkeit der Schaffung gesellschaftlicher Partizipationsmöglichkeiten, um die Ausgrenzung von Randgruppen zu verhindern. Andererseits macht er auf die Bedeutung des interreligiösen Dialogs, der auf der Akzeptanz der jeweils andersgläubigen Seiten aufgebaut sein muss, aufmerksam. Beide Aspekte, so Freise, sind Grundlage dafür, ein nachhaltig friedliches Zusammenleben der Kulturen zu ermöglichen.
Religion kann auf Menschen großen Einfluss haben und eine enorme Bindungskraft entwickeln. Diese Bindungskraft ist ambivalent, denn Religion hat eine dunkle und eine helle Seite. Gerade weil Religion die emotionalen Tiefenschichten des Menschen anspricht, ist sie in der Lage, Fanatismus und Hass hervorzurufen. Es wäre aber falsch, Religion auf ihre dunkle Seite zu reduzieren. Religion kann auch ein Faktor der Selbstermächtigung der Unterdrückten sein. Das Vertrauen auf ihren Gott Jahwe ermutigte die Israeliten, sich gegen die Sklaverei in Ägypten zur Wehr zu setzen. Die Bürgerrechtsbewegung (Civil Rights Movement) in den USA mit Martin Luther King bezog sich auf diese biblische Befreiungserfahrung ebenso wie die Theologie der Befreiung in Lateinamerika. Bei der friedlichen Revolution in der DDR im Jahr 1989 waren die Montagsgebete Ausgangspunkt für anschließende Großdemonstrationen und die friedliche Revolution. Religion kann emanzipatorisch wirken und in Menschen Resilienzkräfte freisetzen.
Religiös motivierte Gewalt: Fundamentalismus als Ausgangsbasis
Die terroristischen Anschläge gegen die satirische Zeitschrift Charlie Hebdo im Januar 2015, einen jüdischen Supermarkt im Februar 2016 und die Anschläge rund um das Fußballländerspiel Frankreich gegen Deutschland im November desselben Jahres haben ebenso wie die Anschläge von Nizza, Paris, Berlin oder Manchester die dunkle Seite von Religion sichtbar werden lassen und das Leben in unseren Gesellschaften verändert. Wir stehen vor der Frage, ob es auch in Zukunft zu weiteren Anschlägen kommen wird und welche angemessenen Sicherheitsmaßnahmen gegen diese Form der Gewalt die adäquatesten sind.
Religiös motivierte Gewalt gibt es in vielen Religionen. Ein religiöser Grund – neben anderen ökonomischen, sozialen, politischen und psychologischen Gründen – ist darin zu sehen, dass die jeweils eigene Religion als etwas Absolutes und als die einzige Wahrheit im Gegensatz zu den Falschheiten anderer Religionen gesehen wird, die notfalls eben auch mit Gewalt durchzusetzen ist. Diese exklusivistische Religionsauffassung wird oft auch mit dem Begriff des Fundamentalismus umschrieben, der inzwischen aber sehr unterschiedlich und zum Teil wie der Terrorismusbegriff als Kampfbegriff benutzt wird. Aber nicht jede religiöse Auffassung, die in der eigenen Religion die einzig wahre sieht, kann gleich als fundamentalistisch etikettiert werden. Die abrahamitischen Weltreligionen des Judentums, Christentums und des Islams beinhalten jeweils für sich einen absoluten Wahrheitsanspruch und haben doch auch ein Potenzial der Toleranz und des Respekts gegenüber anderen Religionen und Weltanschauungen.
Interreligiöser Dialog und gemeinsames Gebet von Muslimen und Christen auf den Philippinen.
Der religiöse Fundamentalismus wird heute als ein Phänomen der Moderne und gleichzeitig als religiös motivierter Widerstand gegen die Moderne gesehen. In einer unüberschaubaren globalisierten Welt mit unterschiedlichsten Weltanschauungen und Religionen, die am gleichen Ort miteinander konkurrieren, wächst das Bedürfnis nach einfachen klaren Orientierungen, die Halt geben. So kann religiöser Fundamentalismus (ob islamisch, christlich, jüdisch oder säkular) als etwas gesehen werden, das in der Moderne entstand und das mittels der Denkmuster der Moderne Widerstand gegen dieselbe leistet. Als fundamentalistisch gelten in diesem Kontext diejenigen, die ihren eigenen Standpunkt verabsolutieren, den Anspruch auf exklusiven Zugang zur religiösen Wahrheit vertreten und dabei keinen Respekt für Andersdenkende und Andersgläubige zeigen. Ihr Denken ist dogmatisch erstarrt; sie schotten sich von der Wirklichkeit ab und zeigen in extremer Form einen fanatischen Eifer in der Verfolgung ihrer Ziele mit dem Hang, Misserfolge auf das Wirken verschwörerischer Kräfte zurückzuführen. Politisch wird religiöser Fundamentalismus oft instrumentalisiert, um eigene Machtinteressen religiös begründet mit Gewalt durchzusetzen.
Wenn wir von Terror sprechen, assoziieren wir damit in erster Linie den islamistischen Terror. Es gibt bei uns in Deutschland aber auch den anderen, rechtsextremen Terror, der sich beispielsweise in Brandanschlägen auf unbewohnte und bewohnte Flüchtlingsheime (allein 2016 zählte das Bundeskriminalamt fast 1.000 Anschläge) oder im gezielten Töten von Menschen mit Migrationsgeschichte durch den Nationalsozialistischen Untergrund äußert.
Der Begriff des Terrorismus wird auch als Kampfbegriff benutzt. Gegnerische Aktivitäten werden in gewaltsamen ethnisch konnotierten Konflikten beispielsweise als terroristische Aktivitäten bezeichnet, während die von der eigenen Gruppe eingesetzte Gewalt als berechtigtes Mittel zum Selbsterhalt oder zur Befreiung definiert wird. So war der IRA-Einsatz der republikanischen Iren für die nordirischen Protestanten klar terroristisch, während die katholisch-republikanischen Iren die IRA als militärischen Arm ihres Befreiungskampfes sahen. Der Anführer der palästinensischen FATAH Jassir Arafat wurde von den Israelis lange Zeit als Terrorist gesucht; später wurde er als Vertreter der Palästinenser anerkannt und erhielt mit Simon Peres den Friedensnobelpreis. Staatliche Gewalt wird im Gegensatz zu einer aus dem Untergrund heraus organisierten Gewalt schneller als legitim gedeutet, und es stellt sich die Frage, ob man nicht auch von einem Staatsterrorismus sprechen müsste, wenn völkerrechtswidrig Gewalt ausgeübt wird. Im Drohnenkrieg gegen Afghanistan und Pakistan, der wohl, wie wir von Edward Snowden wissen, von der US-Basis Ramstein (Rheinland-Pfalz) aus koordiniert wird, sind bereits mehrere tausend Menschen, darunter viele Zivilisten, umgekommen. Andreas Bürkert, Professor für tropische Landwirtschaft, der häufig in Afghanistan unterwegs ist, bezeichnet den Sprengstoffgürtel als die „Drohne des kleinen Mannes“. Man mag einwenden, dass es ein Unterschied sei, ob unschuldige Zivilisten gezielt durch Selbstmordattentäter ums Leben kämen oder als Kollateralschaden bei Angriffen auf einzelne Terrorismus-Verdächtige. Für die Opfer ist dies aber irrelevant. Es ist wichtig zu wissen, dass Drohnenangriffe mit unschuldigen Opfern Menschen weiter in die Hände des Islamischen Staats und anderer Terrororganisationen treiben.
Für den Aachener Friedenslauf 2017 unter dem Motto "Religion ohne Frieden? Das läuft nicht!" entwarfen Studenten dieses Plakat.
Interreligiöser Dialog als Präventionsaufgabe
Religiöse Aufklärung ist ein wichtiger Bestandteil der Präventionsarbeit gegen Fundamentalismus. Sie delegitimiert theologisch den jeweiligen Fundamentalismus wie beispielsweise den Salafismus, der eine menschenfeindliche Form des Islam darstellt. Im Salafismus wird der Mensch zur Marionette eines menschengemachten Gesetzesglaubens. Allah als der Allbarmherzige kommt hier nicht mehr vor. Religiöser gewaltbereiter Extremismus entwickelt sich auf der Basis eines gesetzesfixierten Glaubens, der sich einige Gewaltverse aus den jeweiligen heiligen Schriften heraussucht und daraus eine Gewaltideologie zimmert. Es ist wichtig, diese Konstrukte theologisch zu dekonstruieren. Ohne ein solches fundamentalistisches Koranverständnis finden beispielsweise junge Muslime keinen Ansatz mehr, den Islam als Rechtfertigung für ihre wirren Gedankenkonstrukte heranzuziehen.
Im interreligiösen Dialog gilt es, die Friedenspotenziale der Religionen und auch nichtreligiöser Weltanschauungen hervorzuheben. Jesus von Nazareth ist mit seiner gelebten Gewaltfreiheit hier nicht nur engagierten Christinnen und Christen ein Vorbild – oft gegen gewalthaltige kirchliche Traditionen in ihren eigenen Kirchen. Der Jude Martin Buber sprach von „meinem Bruder Jesus“. Muslimen ist er ein Prophet und gilt als Wort Gottes. Mahatma Gandhi sagte, wenn die Christen Jesu Botschaft der Bergpredigt leben würden, wäre er auch Christ. Hindus sehen in Jesus eine göttliche Reinkarnation. Genauso können Christ*innen in gewaltfreien Vertreterinnen und Vertretern anderer Religionen Vorbilder finden. Viel zu wenig werden Vertreter*innen eines sich gewaltfrei verstehenden Islams wahrgenommen und gewürdigt. Der Paschtune Abdul Ghaffar Khan war ein muslimischer Weggenosse und Mitstreiter Mahatma Ghandis. Immer wieder wurde er wegen seiner Aktionen des zivilen Ungehorsams verhaftet und er verbrachte viele Jahre im Gefängnis. Abdul Ghaffar Khan gründete die Bewegung der Khudai Khidmatgar (Diener Gottes). Diese verpflichteten sich aus ihrem muslimischen Glauben heraus zur Praxis der Gewaltfreiheit und der Vergebung, zu einfachem Lebensstil und zu täglich mindestens zwei Stunden unentgeltlicher sozialer Arbeit. Sie leisteten einen Eid auf den Koran, dass sie nie in einer Armee dienen werden.
Gesellschaftliche Partizipation als Präventionsaufgabe
Religiöse Aufklärung allein wendet aber Fundamentalismus nicht ab. Insbesondere junge Menschen geraten in die Fänge extremistischer Verführer, weil ihnen Möglichkeiten gesellschaftlicher Partizipation fehlen. Wenn Menschen soziokulturelle Kränkungen durch Ausgrenzung erleben, wenn sie von Arbeitslosigkeit bedroht sind oder als ethnische Minderheit keine Anerkennung erfahren, dann ist der Weg zu einfachen Antworten und Schuldzuweisungen nicht weit. Wer in der eigenen persönlichen und sozialen Identitätsentwicklung massiv beeinträchtigt wird, ist besonders gefährdet, Feindbilder zu konstruieren und sich in einer unerschütterlichen Ideologie oder in einer unangreifbaren Heilslehre zu verlieren. Wenn Menschen erleben, dass ihre Stimme nicht gehört wird und dass sie aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden, schaffen sie sich möglicherweise aus Frustration und Ressentiments eine Gegenwelt, die scheinbar Identität stiftet und Sicherheit schafft. Einzelne junge Muslime leben so in ihrer virtuellen „Umma“ (Gemeinde) der neuen sozialen Medien und schotten sich gegen die Umwelt ab, indem alle Andersgläubigen und Andersdenkenden als Heiden und Feinde des Glaubens konstruiert werden. Prävention extremistischen Handelns muss deshalb darauf zielen, dass sich Menschen nicht aufgrund von Arbeitslosigkeit oder aufgrund ihrer Migrationsgeschichte ausgegrenzt fühlen. Überall wo Partizipation und Integration gelingen, wird der Gefahr von Extremismus vorgebeugt. Die vielfältigen Anstrengungen der Jugendsozialarbeit und insbesondere auch der Jugendmigrationsdienste in Deutschland haben sicherlich mit dazu beigetragen, dass jugendliche Bandenbildung, wie sie aus den Vororten französischer Großstädte bekannt ist, im großen Stil bisher verhindert werden konnte.
Der interreligiöse Dialog kann das friedliche Zusammenleben in einer Gesellschaft stärken, aber es bedarf vieler anderer Faktoren, um Populismus, Gewalt und Terror zu verhindern und nachhaltigen Frieden zu stiften. Wir wissen heute nur zu gut, dass Fundamentalismus und die Bereitschaft zu Gewalt auf einem Nährboden wachsen, der zumeist andere als religiöse Ursachen hat. Der Nährboden besteht oft aus wirtschaftlicher Not, aus sozialen Abstiegs- und Ausgrenzungserfahrungen sowie aus einem Vertrauensverlust in die Arbeit der politischen Eliten. Das alles treibt Menschen in die Arme von Populisten und Extremisten. Sich gegen wirtschaftliche, soziale und religiöse Ausgrenzung zu engagieren, hat deshalb auf dem Weg zu einem friedlichen Zusammenleben oberste Priorität.
Buchtipp: Kulturelle und religiöse Vielfalt nach Zuwanderung
Theoretische Grundlagen – Handlungsansätze – Übungen zur Kultur- und Religionssensibilität
In diesem im Wochenschau-Verlag veröffentlichten neuen Buch von Dr. Josef Freise, das im Herbst erscheinen wird (ca. 272 S.), sucht der Autor nach Antworten auf die Fragen, wie die Gesellschaft mit der kulturellen und religiösen Vielfalt in der Gesellschaft umgeht, die aufgrund der Migration von Arbeitskräften und geflüchteten Menschen immer größer wird. Wie gelingt Integration? Wie können Feindbilder und Rassismus verhindert werden? Das Buch will theoretisches Wissen und praktische Orientierungen in sozialen Berufsfeldern geben, in denen sich Professionelle und Ehrenamtliche vor Herausforderungen gestellt sehen, die aus Migration und Flucht entstanden sind.